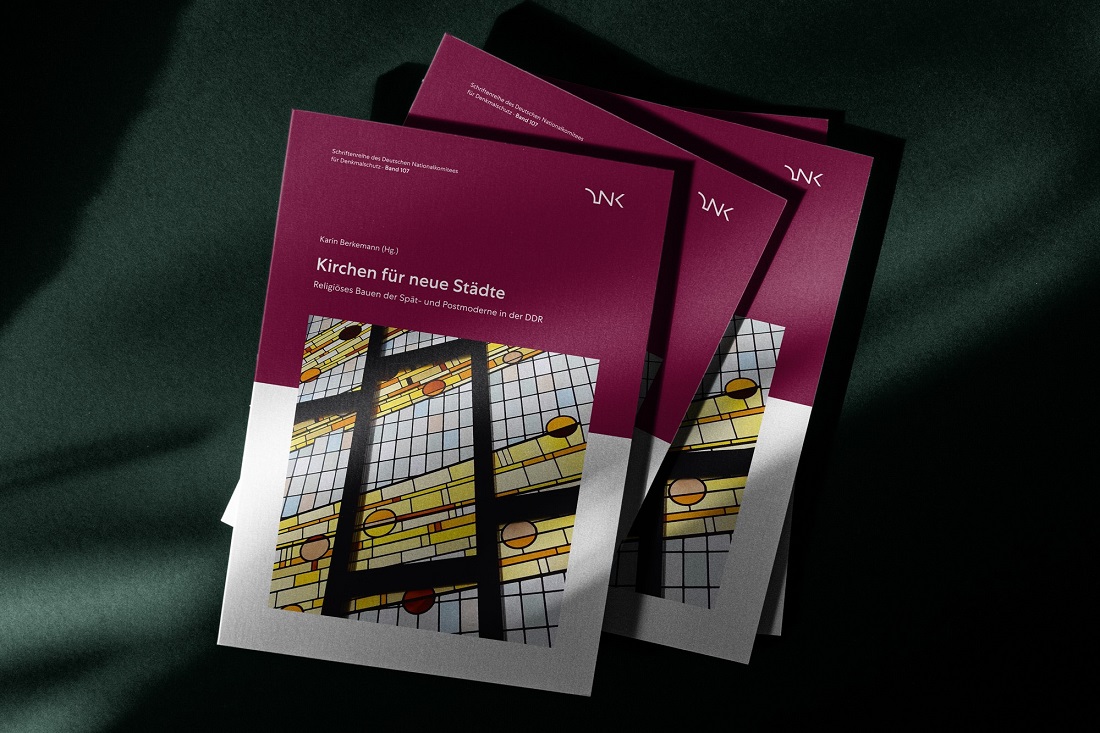Wolfgang Thierse (Bundestagspräsident a. D.) und Susanne Wartzeck (Präsidentin des BDA), der DAM-Kurator Oliver Elser (SOS Brutalism) und der Fotograf Martin Maleschka (Institut für Ostmoderne e. V.) und viele mehr unterstützen als Erstunterzeichner:innen den Aufruf: „Kirchen sind Gemeingüter!“ Die initiative kirchenmanifest.de – ein breit aufgestelltes Bündnis von zehn Partner:innen aus Baukultur, Forschung und Stiftungswesen, darunter Karin Berkemann (Uni Greifswald/moderneREGIONAL) – ruft „dazu auf, der neuen Lage mit neuen Formen der Trägerschaft zu begegnen: mit einer Stiftung oder Stiftungslandschaft für Kirchenbauten und deren Ausstattungen.“
Die Hintergründe für die damit angestoßene Debatte sind, wie es das Manifest zusammenfasst: „Immer weniger Gläubige nutzen die Räume, die Kirchensteuereinnahmen sinken, immer mehr Bauten werden außer Gebrauch gestellt oder gar abgerissen.“ Dem stellt das Papier ein ganzes Bündel von Argumenten entgegen: Kirchen sind mehrfach codierte Orte, die Teilhabe einfordern. Theologisch argumentiert, sind sie radikal öffentliche Orte. Zwischen Arbeitsplatz und Zuhause dienen sie als Dritte und Vierte Orte, die Sinn- und Chancenräume anbieten. Und sie sind, samt ihrer Ausstattung, nachhaltiges Kulturerbe. Für Kirchen der Moderne ist besonders hervorzuheben: In „ihrer Auseinandersetzung mit der modernen Gesellschaft bieten sie wertvolle Reibungsflächen, um unsere freie demokratische Gesellschaft weiterhin erfahrbar zu machen.“ Kurz gesagt: Kirchen (jeden Alters) gehören allen. Deshalb fordert die initiative kirchenmanifest.de einen Schulterschluss, eine „breit aufgestellte Verantwortungsgemeinschaft mit Staat, Gesellschaft und weiteren Akteurinnen und Akteuren“.
zur Seite der Initiative
Aktuelles
+++ 20./21. Mai: Interview mit Karin Berkemann, Universität Greifswald, im Deutschlandfunk Kultur +++ 19. Mai: zu Pfingsten ein Interview mit Thomas Sternberg, Präsident der Kunststiftung NRW, im SWR 1 und ein heiterer Zwischenruf aus der Jazzmusik +++ 18. Mai: wow, über Nacht fünfstellig +++ 17. Mai: die 5.000 sind erreicht +++ 16. Mai: Süddeutsche berichtet +++ wir sind vierstelllig +++ 15. Mai: Deutschlandfunk berichtet +++ die 500er-Marke ist geknackt, nächstes Ziel: vierstellig +++ 14. Mai: Domradio, WDR, katholisch.de, Kirche und Leben, Neues Ruhrwort und Evangelische Zeitung berichten +++ wir nähern uns mit großen Schritten den 500 Unterstützenden +++ 12. Mai: die 200er-Marke ist geknackt! +++ 11. Mai: noch nicht 24 Stunden online, und die ersten 100 Unterstützenden sind zusammen – nächstes Ziel: Verdoppeln! +++ 10. Mai: das Kirchenmanifest geht online – und während wir beim ESC mitfiebern, trudeln auch bei uns die ersten guten Zahlen ein +++
hier unterzeichnen
Titelmotiv: Berlin-Spandau, Zufluchtskirche: Eigentlich sollte die Zufluchtskirche, 1967 fertiggestellt nach Entwürfen des Architekten Bodo Fleischer, zum Stadtteilzentrum mit Kindergarten umgebaut werden. Doch 2023/24 wurde das Ensemble abgerissen, um an seiner Stelle ein neues Stadtteilzentrum zu errichten (Bild: Gunnar Klack, 2019)